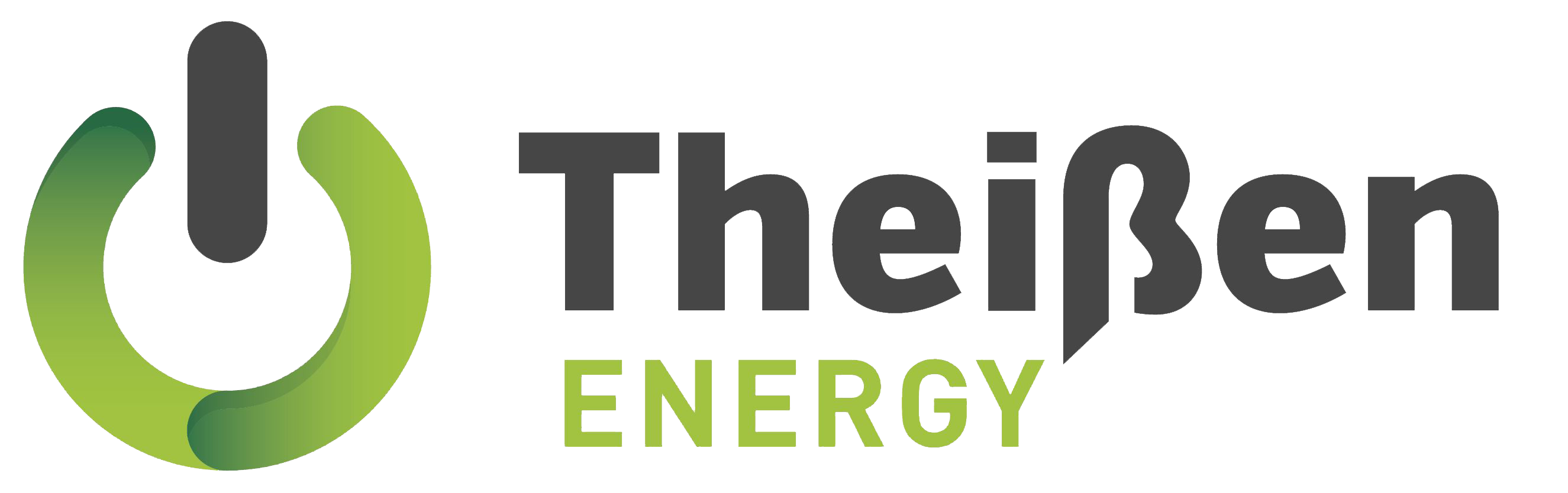Praxiswissen →
Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung: Vor- und Nachteile

In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender Umweltbewusstheit rücken alternative Energieversorgungsmodelle wie Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung zunehmend in den Fokus.
Beide Konzepte bieten innovative Ansätze zur Nutzung erneuerbarer Energien, bringen jedoch sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich.
Was ist Mieterstrom?
Mieterstrom bezeichnet die Bereitstellung von Strom, der direkt vor Ort erzeugt wird, zum Beispiel durch Photovoltaikanlagen auf dem Dach eines Wohngebäudes. Die erzeugte Energie wird in erster Linie den Mietern des Hauses zur Verfügung gestellt, wodurch eine unabhängige und direkte Versorgung gewährleistet ist.
Vorteile des Mieterstroms
Kostensenkung: Mieter können von günstigeren Strompreisen profitieren, da sie den Strom direkt vom Erzeuger beziehen, anstatt ihn über einen klassischen Anbieter einzukaufen. Dies kann langfristig zu erheblichen Einsparungen führen.
Nachhaltigkeit: Durch die Nutzung erneuerbarer Energien, wie Solarkraft, tragen Mieterstromprojekte aktiv zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und zur Bekämpfung des Klimawandels bei.
Unabhängigkeit: Mieter sind weniger von Preisschwankungen auf dem Energiemarkt betroffen, was ein gewisses Maß an Preisstabilität bietet.
Förderprogramme: In Deutschland gibt es verschiedene Förderungen und gesetzliche Anreize, die den Ausbau von Mieterstromanlagen unterstützen.
Nachteile des Mieterstroms
Investitionskosten: Die erstmalige Anschaffung und Installation von Photovoltaikanlagen kann kostspielig sein, was eine Hürde für viele Eigentümer darstellt.
Rechtliche Rahmenbedingungen: Die gesetzliche Regulierung im Bereich Mieterstrom ist komplex und kann von Bundesland zu Bundesland variieren. Dies erfordert oft rechtliche Beratung und kann die Umsetzung erschweren.
Technische Abhängigkeit: Die Leistung und Effizienz der Anlagen hängen stark von Witterungsbedingungen ab, was zu Schwankungen in der Stromversorgung führen kann.
Verwaltung: Mieter müssen sich möglicherweise vertraglich verpflichten und vereinbarte Nutzungskosten über längere Zeiträume hinweg berücksichtigen.
Was bedeutet gemeinschaftliche Gebäudeversorgung
Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung funktioniert ähnlich wie der Mieterstrom, schließt jedoch oft mehrere Gebäude oder sogar ganze Nachbarschaften ein. Hierbei wird der erzeugte Strom ebenfalls vor Ort genutzt, allerdings können auch größere Solaranlagen oder andere erneuerbare Energiequellen zum Einsatz kommen.
Beispiel: Ein Investor, in der Regel der Vermieter, errichtet eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses und schließt mit interessierten Bewohner:innen des Hauses einen Vertrag über die Lieferung von Strom aus dieser Anlage.
Die Haushalte im Gebäude können den lokal erzeugten Strom verwenden, und zwar zu einem günstigeren Preis als den für Netzstrom. Ein Teil des Strombedarfs kann durch Solarstrom gedeckt werden, während jeder Haushalt für den restlichen Bedarf weiterhin seinen Stromanbieter nach freier Wahl auswählen kann.
Vorteile der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung
Skaleneffekte: Größere Anlagen ermöglichen oft Kostensenkungen durch bessere Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Die Investitionskosten verteilen sich auf mehrere Nutzer.
Erweiterter Nutzen: Gemeinschaftliche Projekte können zusätzliche Anreize schaffen, zum Beispiel durch die Möglichkeit der Speicherung von überschüssigem Strom.
Stärkung der Gemeinschaft: Solche Projekte fördern den Zusammenhalt innerhalb einer Nachbarschaft und schaffen ein Bewusstsein für nachhaltige Energieversorgung.
Nachteile der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung
Komplexität der Organisation und Messtechnik: Die Verwaltung und Abstimmung unter verschiedenen Parteien kann herausfordernd sein und erfordert häufig eine klare vertragliche Regelung.
Teilnehmerbindung: Bewohner müssen bereit sein, sich langfristig an das Projekt zu binden, was nicht immer einfach ist.
Technologische Abhängigkeiten: Ein wesentlicher Aspekt stellt der Aufwand für die Messkonzepte dar. Die Daten müssen viertelstündlich gemessen und abgerechnet werden, um den erzeugten und verbrauchten Strom jedes Teilnehmers genau zu erfassen. Für diesen Prozess ist eine hochentwickelte Messtechnik notwendig, was zu hohen Kosten führt – vor allem im Wohnbereich. Viele Netzbetreiber haben zudem nicht die erforderliche Infrastruktur, um diese Abrechnungssysteme zu implementieren. Dies hat oft die Folge, dass sich solche Projekte verzögern oder sie gar nicht umgesetzt werden.
Regulatorische Unsicherheiten: Auch hier können rechtliche und regulatorische Anforderungen hinderlich sein, insbesondere bei der Einbeziehung mehrerer Eigentümer und Nutzer.
Fehlender Mieterstromzuschlag: Ein weiterer Nachteil der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung besteht darin, dass sie im Gegensatz zum klassischen Mieterstrommodell keinen Anspruch auf den Mieterstromzuschlag nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bietet. Diese Option der Förderung fällt weg, wodurch das Modell finanziell weniger attraktiv wird, insbesondere im Vergleich zur Vollversorgung im Mieterstrommodell.
Für welche Objekte eignet sich…
die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung
Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung eignet sich speziell für kleinere Einzelobjekte, für die der organisatorische Aufwand des Mieterstroms zu groß wäre.
- Lieferung von ausschließlich PV-Strom aus Gebäudestromanlage zum
Verbrauch durch Dritte in demselben Gebäude - Der Vermieter verrechnet nur den Solarstrom an den Mieter
- Der Mieter ist selbst für die Reststrommengenbeschaffung verantwortlich und schließt mit einem Stromlieferanten seiner Wahl einen Vertrag
- Der Mieter hat zwei Verträge: einen mit dem Vermieter und einen mit dem Stromlieferanten seiner Wahl
die Mieterstrom-Regelung
Mieterstrom-Modelle eignen sich besonders dann, wenn große (ab ca. 15 Wohneinheiten) oder mehrere Objekte im gleichen Quartier mit selbst erzeugtem Strom aus PV-Anlagen von Gebäuden und Nebenanlagen versorgt werden sollen, unter der Voraussetzung, dass keine Netzdurchleitung notwendig ist.
- Der Vermieter übernimmt volle Lieferantenpflichten, inkl. Reststrombeschaffung (Vollversorgungsgebot)
- Der Mieter erhält nur eine Abrechnung
Beispielhaftes Szenarien für Mieterstrom und die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung – (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)
Fazit
Sowohl Mieterstrom als auch gemeinschaftliche Gebäudeversorgung bieten vielversprechende Chancen, die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu sparen. Allerdings sind beide Modelle nicht ohne Herausforderungen. Eine sorgfältige Planung, klare vertragliche Regelungen und das Engagement aller Beteiligten sind entscheidend, um die Vorteile dieser innovativen Versorgungskonzepte optimal zu nutzen. In Anbetracht des wachsenden Bedarfs an nachhaltiger Energieversorgung könnten diese Ansätze in Zukunft einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten.
Wir beraten Sie gerne individuell, welches Modell für Ihr Projekt und die Rahmenbedingungen die optimale Lösung ist, und unterstützen Sie gerne von A wie Antragsstellung bis Z wie Zählersanierung.